 Dr. Jakob Vicari ist freiberuflicher Wissenschaftsjournalist und lebt in Lüneburg. Er hat das Format der Sensorstory entwickelt und ist einer der Initiatoren des Sensorjournalismus-Projekts „Superkühe“ im WDR. Hierfür wurden die Daten dreier Milchkühe über einen Zeitraum von 30 Tagen von Sensoren ermittelt und journalistisch aufbereitet. Eine Messenger-Anbindung sorgte unter anderem dafür, dass Rezipienten mit den Kühen „chatten“ konnten. Auf diese Weise soll das Internet der Tiere journalistisch genutzt werden, um Geschichten neu zu erzählen und die Aufmerksamkeit eines vernetzten, aktiven Publikums über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten.
Dr. Jakob Vicari ist freiberuflicher Wissenschaftsjournalist und lebt in Lüneburg. Er hat das Format der Sensorstory entwickelt und ist einer der Initiatoren des Sensorjournalismus-Projekts „Superkühe“ im WDR. Hierfür wurden die Daten dreier Milchkühe über einen Zeitraum von 30 Tagen von Sensoren ermittelt und journalistisch aufbereitet. Eine Messenger-Anbindung sorgte unter anderem dafür, dass Rezipienten mit den Kühen „chatten“ konnten. Auf diese Weise soll das Internet der Tiere journalistisch genutzt werden, um Geschichten neu zu erzählen und die Aufmerksamkeit eines vernetzten, aktiven Publikums über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten.
Die Interviews führten Marie Herrmann und Laura Sprenger für eine Forschungsarbeit zum Thema „Animal Tracking und Sensorjournalismus: Das narrative Potential von Tieren im Kontext der Digitalisierung“ im Master-Studiengang Medienentwicklung, betreut von Prof. Dr. Torsten Schäfer.
Wie sind Sie auf das Projekt „Superkühe“ gekommen und welche Vorbereitungen mussten dafür getroffen werden?
Ganz am Anfang war das eine ziemliche Schnapsidee: Ich wollte live und automatisiert mit Hilfe von Roboterjournalismus über Wissenschaft berichten. Das war im Jahr 2016. Als Wissenschaftsjournalist begegnet einem in der Berichterstattung oft nur das Ergebnis. Aber Wissenschaft ist ein Prozess. Ich dachte mir, dass es doch irgendwie möglich sein müsste, die Daten, die dort erhoben werden, live zugänglich zu machen. Das war der Grundstein, aus dem das Format Sensorstory wurde. Ich habe mit Kollegen überlegt, was der naheliegendste Fall wäre, um Sensor-Journalismus das erste Mal im großen Stil einzusetzen. Da sind wir auf Landwirtschaft gekommen und haben das sehr schnell auf Kühe eingegrenzt. Das hat die Kollegen beim WDR sofort überzeugt.
Hat der technologische Standard in der Landwirtschaft dabei eine Rolle gespielt?
Nicht vorrangig. Am Anfang stand tatsächlich die technologische Idee, dass ich die Sensordaten, die ich als Journalist brauche, komplett selbst erheben kann, mit eigener Hardware. Ich habe dann am Medieninnovationszentrum Babelsberg die Reporterbox entwickelt, ein Stück Hardware: eine blaue Aluminiumbox mit einem USB-Anschluss, einer Mobilfunkverbindung, einem Display und zwei Steckern, an denen man Sensoren anschließen kann. Dafür haben wir uns ein Redaktionssystem gebaut, das Sensordaten verarbeiten kann. Das war der Ausgangspunkt. Im Laufe der Recherche haben wir uns Bauernhöfe angeschaut und festgestellt, dass dort alles schon sehr verdatet ist: Tiere in der Landwirtschaft sind vernetzt, weil sie kontrolliert, nachverfolgt und gemeldet werden müssen. Da haben wir uns entschieden, in der Landwirtschaft bewährte Sensortechnik einzusetzen.
Können Sie kurz zusammenfassen, welche Reaktionen das Projekt ausgelöst hat?
Das war Wahnsinn. Milchviehhaltung ist ein Thema, das sehr ideologisch diskutiert wird, was für uns ja auch ein Grund dafür war, einen neuen Zugang dazu zu suchen: Eine Sensorstory erfordert eine neue Erzählperspektive und eine sehr faktenbasierte Erzählweise. Uns war auch klar, dass wir es bei einem Live-Projekt mit dem ständigen Feedback der Leser oder Zuschauer zu tun haben würden. Überraschend war, wie intensiv die Diskussion dann wurde. Das war im Rückblick eine sehr positive journalistische Erfahrung. Man tut etwas und bekommt direktes Feedback. Bestimmte Gruppen haben schon vor dem Start des Projektes sehr stark reagiert, vor allem Tierrechtler. Da schien das Urteil schon festzustehen. Das fand ich schade, weil wir das Projekt bewusst ergebnisoffen angelegt haben und ein Aufklärungsinteresse hatten.

Würden Sie persönlich Superkühe als Erfolg bewerten?
Auf jeden Fall! Dass man als freier Journalist eine innovative Idee hat und daraus ein sehr großes Projekt wird, das viele andere Leute sehen. Die Reichweite betrug fast zwei Millionen Zuschauer. Dass es belohnt wurde, dass man das ganze Thema Milch noch einmal auf eine neue Art betrachtet hat. Dass wir es geschafft haben, das populär zu machen. Und vor allem: dass wir ein neues Erzählverfahren ausprobiert haben, das so viele Leser angenommen und als Mehrwert empfunden haben.
Würden Sie Sensor-Journalismus als Gefährdung des herkömmlichen Journalismus betrachten?
Nein. Ich sehe den Sensor-Journalismus als Erweiterung und Werkzeug, um den Journalismus besser zu machen. Und da meine ich ausdrücklich auch die Roboterjournalismus-Komponente. Für mich ist Sensorjournalismus auch ein Ansatz, mit meiner Berichterstattung objektiver zu werden. Die Live-Sensordaten erzeugen Unmittelbarkeit und eine faktische Grundierung. Wenn mir jemand sagt: Der Milchkuh im Stall geht es schlecht, dann kann ich antworten: Aber alle Vitalwerte der Kuh sagen etwas anderes. Darauf basiert meine Berichterstattung.
Auf der Homepage zur Sensor-story heißt es: „Gleichzeitig nimmt die personelle Ausstattung von Redaktionen ab. Technologie bietet die Chance, diese Lücke zu füllen.“ An Superkühe“ waren jedoch trotzdem über 20 Journalisten beteiligt. Wie passt das zusammen?
Sensorjournalismus stellt ja ganz andere Anforderungen an Dramaturgie und journalistische Komposition. SUPERKÜHE hatte den Ansatz, die Technologie erstmals zu nutzen, einen neuen Journalismus mitzuerfinden. Der Slogan, der auf unseren Geräten stand, lautete: „No reporters were harmed“. Wir wollten keine Journalisten abschaffen oder überflüssig machen, wir wollen den Journalismus besser machen. Ein Sensor kann dort sein, wo ein Reporter nicht sein kann. Und zwar rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Wenn zum Beispiel ein Storch auf dem Weg nach Afrika über Bürgerkriegsgebiete in Syrien fliegt, könnten wir feststellen, wie es ihm dabei geht. Das ist die Idee hinter der Nutzung dieser Technologie: Einen neuen Journalismus zu erfinden, bevor die Technologie rein ökonomisch getrieben weiterentwickelt wird von den großen Internetkonzernen.
Wie können Sensordaten das Verhältnis von Mensch und Tier möglicherweise beeinflussen?
Sensorjournalismus kann zeigen, wie es um das Verhältnis Mensch und Tier bestellt ist. Der Anspruch unseres Projekts war, Milchkühen eine Stimme zu geben. Wir haben einen Sensor dort platziert, wo, wie ein Bauer sagte, die Seele der Kuh sitzt, nämlich im Kuhpansen. Und wir haben einen Kunstgriff gewagt: wir haben für die Berichterstattung die Ich-Perspektive der Kuh gewählt, was ja nicht ganz einfach ist. Von daher kann das, glaube ich, schon ein neues Verständnis für das Leben der Milchkühe vermitteln und dem Verbraucher den kausalen Zusammenhang zwischen den Fragen „Wie lebt die Kuh?“ und „Wie viel Geld bezahle ich für die Milch?“ verdeutlichen.

Aber ersetzt das den direkten Kontakt mit Tieren?
Nein. Der Kontakt zum Nutztier ist bei den meisten Zuschauern ja erstmal gar nicht da, zum Wildtier erst recht nicht. Da gibt es viele Geheimnisse, die erst mithilfe der Sensortechnologie gelüftet werden. Durch die neuen kleineren Sensoren, zum Beispiel beim ICARUS-Projekt, kann man endlich auch kleinere Tiere tracken. Das ist eigentlich auch der Zoo-Gedanke: Man kann nur das schützen, was man kennt und wozu man einen Bezug hat.
Wie würden Sie das Verhältnis von Internet bzw. Technik und Tieren aus ethischer Sicht beurteilen?
Ich habe erstmal relativ wenig Bedenken, Tiere zu verdrahten. Wir nutzen erhobene Daten, um unsere Geschichten zu erzählen. Das finde ich sehr legitim und sehe keine Notwendigkeit für Kuh-Datenschutz.
Kann man den in SUPERKÜHEN gewonnenen Daten denn blind vertrauen? Sie sind ja nicht ganz nachvollziehbar, sondern schon verarbeitet.
Vertrauen ist ein Grundproblem des Journalismus. Deswegen haben wir nicht nur berichtet, sondern gleichzeitig unsere Daten veröffentlicht, um Vertrauen zu schaffen. Ich schreibe „Der Kuh geht es gut«, und wenn du mir nicht glaubst: Hier sind die Daten dazu. Das ist mehr, als der normale Journalismus liefert. Die Sensordaten sind eine vertrauensbildende Maßnahme. Sie sind live und sie sind überprüfbar. Das sind zwei Aspekte, die Manipulation viel weniger wahrscheinlich machen.
Ist datenbasierter Journalismus auch als Antwort auf das sogenannte „postfaktische Zeitalter“ zu verstehen?
Es gibt eine wachsende Sehnsucht nach Daten, bei Lesern und Kollegen. Ich glaube, datenbasierter Journalismus hat ein großes Potential. Aber man darf nicht dem Fehler unterliegen, die Leser mit Daten zu überschütten und mit Komplexität zu überfordern. Dann hat der Leser irgendwelche Daten und kann damit wenig anfangen. Deswegen glaube ich, dass man die Daten als Journalist auch erklären, einordnen und interpretieren muss. Ich glaube nicht an die reinen Daten, sondern immer noch an die journalistische Geschichte, die mithilfe der Daten erzählt wird. Auch Sensordaten brauchen das Versprechen einer Dramaturgie, damit aus ihnen eine gute Geschichte wird. Auch wenn diese Dramaturgie weniger planbar ist. Dann ist Sensorjournalismus eine der besten Antworten auf die Unsicherheit der Gegenwart.
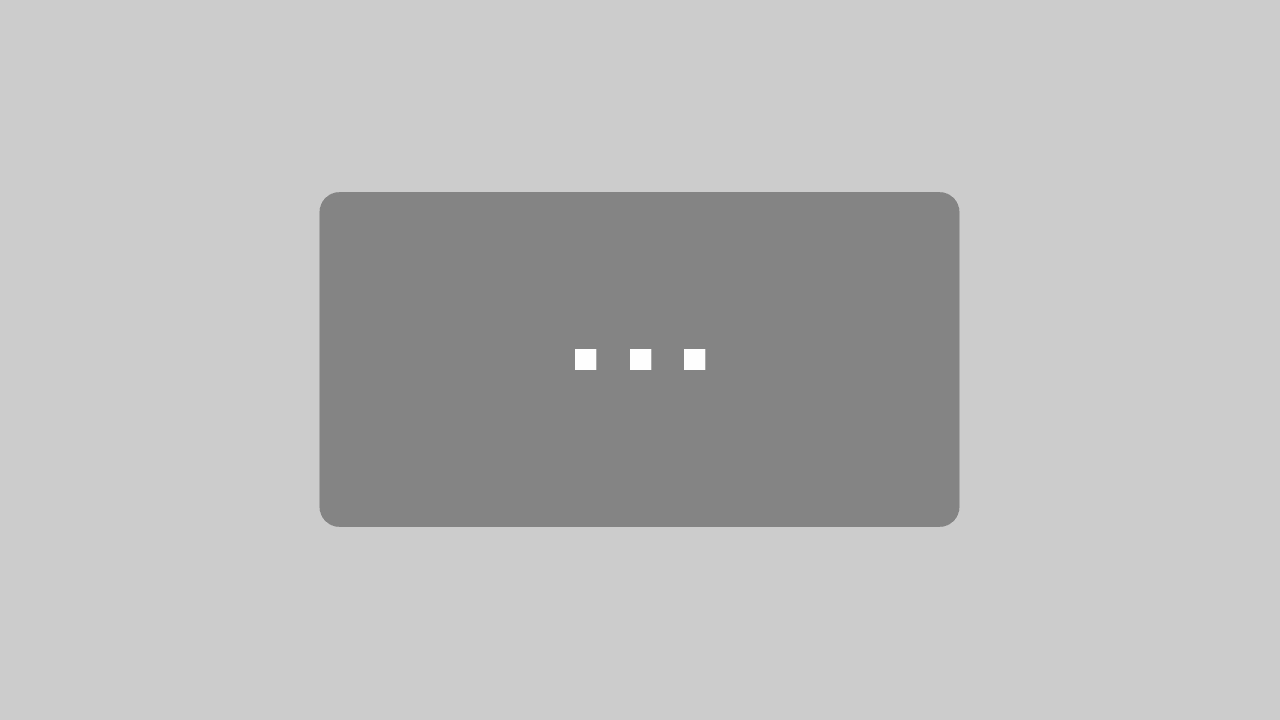
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren


